Medizin: Mit Miniorganen zum passenden Medikament
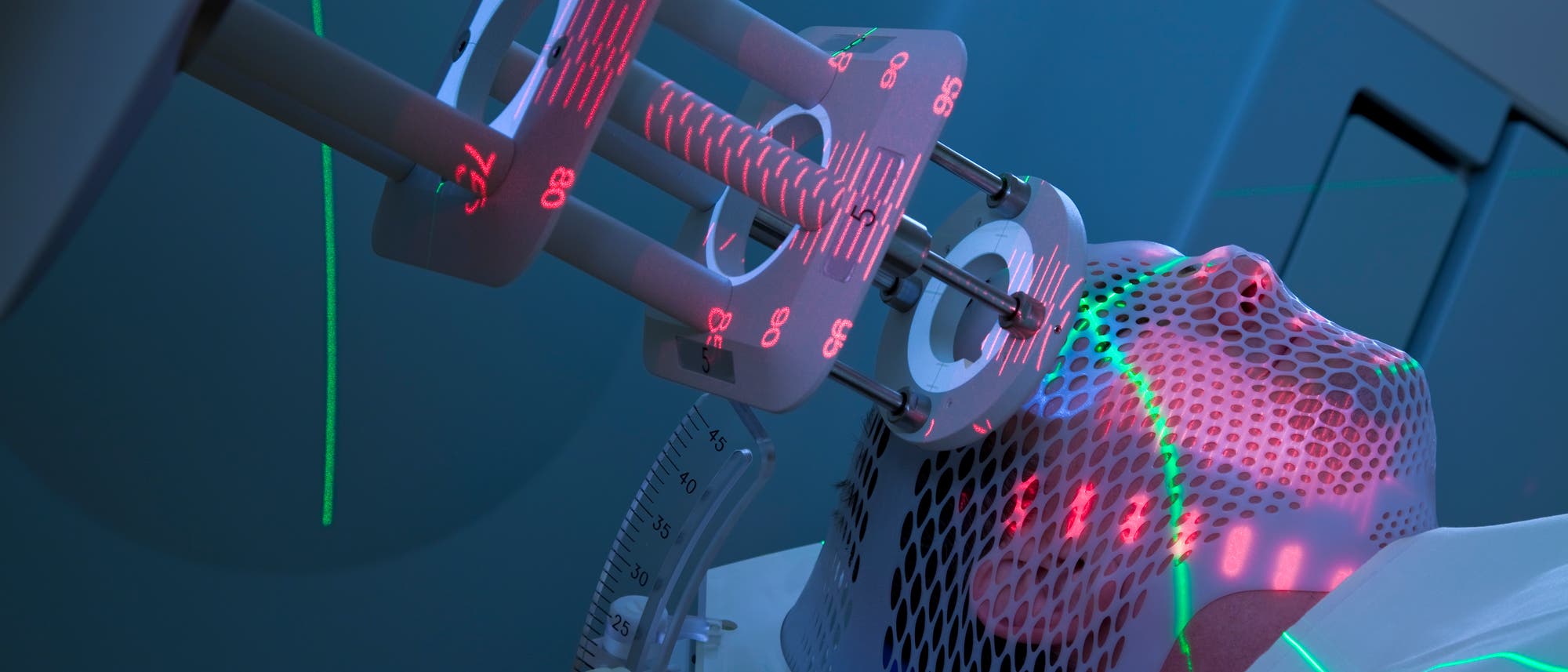
Eine Zukunftsvision: Lediglich ein paar Zellen entnehmen Ärztinnen und Ärzte ihren Patienten, doch im Labor können sie an deren erkrankten Organen testen, wie gut ihre Therapien wirken. Nur wenige Millimeter Durchmesser haben die Herzen oder Gehirne aus der Petrischale, doch sie reagieren auf Medikamente genau so wie ihre echten Gegenstücke.
Eine Zukunftsvision, die in greifbarer Nähe scheint. Bis zu einem gewissen Grad erschaffen Forscher schon heute im Labor solche Organoide, erbsengroße Miniorgane wie etwa Darmorganoide, Minihirne oder gar Tumororganoide, die einen Tumor abbilden sollen.
Für diesen Zweck greifen Forschende oft auf menschliche so genannte induzierte pluripotente Stammzellen (ipS-Zellen) zurück, gewissermaßen umprogrammierte künstliche Körperzellen. Dafür kultivieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits differenzierte, also fertig ausgebildete Körperzellen, zum Beispiel Hautzellen. Durch Zugabe bestimmter Substanzen programmieren sie sie so um, dass diese sich wieder wie embryonale Stammzellen verhalten und sich in fast jeden Zelltyp wie Darmzellen oder Nervenzellen entwickeln können.
Unter bestimmten Kulturbedingungen in Bioreaktoren organisieren sich die Stammzellen nach und nach zu dreidimensionalen Gebilden, die Organen im Miniformat ähneln. Da die Zellen aus Proben von Patienten stammen, lassen sich patientenspezifische Organoide herstellen und daran vorab Medikamente testen.
Das ist auch dringend nötig, denn Menschen reagieren teilweise unterschiedlich auf Wirkstoffe. In der klinischen Praxis ist daher oftmals Trial and Error angesagt. Die Ärztinnen und Ärzte müssen verschiedene Wirkstoffe ausprobieren und die Patienten unter Umständen diverse Nebenwirkungen in Kauf nehmen, bevor eine Therapie anschlägt.
Reaktion auf Medikamente vorhersagen
Beispiel Mukoviszidose: Sie ist nicht nur eine Erbkrankheit, die schwere Auswirkungen auf die Lunge und den Verdauungsapparat hat. Sie erweist sich auch als eine sehr vielgestaltige Erkrankung. Die Hälfte der Patientinnen und Patienten hat Probleme auf Grund einer spezifischen Mutation des Gens CFTR, das den Bauplan für ein Membranprotein enthält. Die andere Hälfte hat andere Probleme durch individuelle und unterschiedliche Mutationen in dem gleichen Gen.
Mit Hilfe von Organoiden lassen sich mittlerweile die Reaktionen der Betroffenen auf Behandlungen recht gut vorhersagen. In einer Studie von 2019 hat das Team um Jeffrey Beekman vom University Medical Center Utrecht Organoide verwendet, die aus Darmzellen von 24 Patienten mit Mukoviszidose abgeleitet waren. Je nach Mutation des CFTR-Gens bekamen sie unterschiedliche Medikamente. In allen 24 Fällen konnten die Forschenden anhand der Reaktionen der Organoide vorhersagen, wer auf die Medikamente ansprechen würde – und in 80 Prozent der Fälle, bei wem es nicht wirkte.
»Holland hat 1500 Mukoviszidose-Patienten. Unser Ziel ist es, eines Tages Organoide all dieser Patienten in unserer Biobank zu haben«Hans Clevers, Molekulargenetiker
Tatsächlich ist im Fall von Mukoviszidose der Organoidtest schon bei den Patienten angekommen, zumindest in den Niederlanden. Maßgeblich daran beteiligt war Hans Clevers. Der Molekulargenetiker gilt als Vater der Organoide und arbeitet am Hubrecht Organoid Technology (HUB), einem niederländischen Non-Profit-Unternehmen. In den Biobanken von HUB lagern Organoide von rund 700 Mukoviszidose-Patienten.
»Holland hat 1500 Mukoviszidose-Patienten«, sagt Clevers. »Unser Ziel ist es, eines Tages Organoide all dieser Patienten in unserer Biobank zu haben.« Das soll eine personalisierte Behandlung ermöglichen. »An den individuell erstellten Organoiden können wir vorab testen, ob das Mukoviszidose-Medikament Orkambi bei einem bestimmten Patienten anschlagen wird oder nicht.« Die bisherige Behandlung mit Orkambi sei für Patienten gedacht, die die gleiche Mutation haben. Aber es sei unklar, ob das Medikament auch bei den anderen Patienten die Symptome eindämmt.
»In den Niederlanden ist das Verfahren im Fall von Orkambi bereits Teil des Gesundheitssystems«, so Clevers. Alle Patientinnen und Patienten, die zwar nicht die spezifische Mutation auf dem CFTR-Gen haben, deren Organoide aber positiv auf Orkambi ansprechen, bekommen das Medikament auch. Das sei weltweit einzigartig. »Die Organoid-Technologie ist im Kommen und mittlerweile gut etabliert«, bestätigt der Biotechnologe Peter Ertl von der Technischen Universität Wien. »Im Fall von Mukoviszidose ist der Vorteil nicht nur, dass man herausfinden kann, welches Medikament wirkt und welches nicht, sondern auch, in welcher Konzentration das Medikament wirkt oder ob eine Kombinationstherapie sinnvoll ist.«
Kein Patient gleicht dem anderen
Auch beim Thema Krebs ist eine der großen Hürden in der Behandlung, dass kein Patient dem anderen gleicht. Schuld daran ist die unterschiedliche Genetik von Tumoren. Deswegen ist für die einen Erkrankten ein Medikament ein Segen, bei anderen dagegen lässt es nur Hoffnungen zerplatzen. Forscher träumen davon, mit Hilfe der Miniorgane für die jeweiligen Patienten das beste Medikament zu finden.
»Bei Krebs sind wir noch nicht so weit«, dämpft Hans Clevers die Erwartungen. Einer der Gründe: Bei vielen Krebsarten gibt es bereits sehr gute und etablierte Therapien. »Wir müssen daher zeigen, dass die Organoide besser sind als die aktuellen Ansätze, bei denen man etwa vor der Therapie das Gewebe der Patienten und die DNA des Tumors untersucht.« Es gebe mittlerweile aber eine Reihe von Studien, die eine hohe Vorhersagekraft der Organoide etwa bei Darmkrebs zeigen.
Nicola Valeri vom Londoner Institute of Cancer Research griff für eine viel zitierte Studie von 2018 zu Tumorzellen von Patienten mit Krebserkrankungen des Magen-Darm-Trakts. An den daraus hergestellten Organoiden testeten die Wissenschaftler dann Medikamente, die noch in der klinischen Erprobung steckten. Vielfach reagierten die Organoide, wie es zum jeweiligen genetischen Profil der Tumore passte. Denn Mutationen sind nicht nur der Auslöser für das unkontrollierte Wachstum der Krebszellen, sie bestimmen auch, wie Betroffene auf Medikamente ansprechen.
Aber würden sich die Resultate auch mit der Reaktion der tatsächlichen Patienten decken? Um das herauszufinden, testete das Forschungsteam an den Minitumoren Medikamente, mit denen die Erkrankten im Rahmen von klinischen Studien therapiert wurden. Beispielsweise untersuchte es die Wirkung von Regorafenib, einem Hemmstoff, der die Blutversorgung des Tumors reduziert.
Bei einem Tumororganoid eines Patienten, der positiv auf das Medikament angesprochen hatte, ging ein Teil der Blutgefäße tatsächlich signifikant zurück. Bei dem Tumororganoid eines anderen Patienten, der nicht positiv auf die Behandlung reagiert hatte, zeigte sich hingegen keine Verbesserung. Insgesamt erlaubten die Organoide zu 88 Prozent erfolgreiche Prognosen, ob ein Patient auf eine Therapie ansprach, und zu 100 Prozent, ob ein Patient nicht positiv reagierte.
Organoide sagen Erfolg einer Chemotherapie voraus
Eine der Standardbehandlungen und das Rückgrat der Krebstherapie ist die Chemotherapie. Aber sie hat nicht nur starke Nebenwirkungen, sondern vielen Patienten hilft die Behandlung auch nicht. Forschende um Hans Clevers und den Molekularonkologen Emile Voest vom Netherlands Cancer Institute in Amsterdam sammelten daher im Rahmen einer multizentrischen Studie Proben von 61 Patienten mit metastasierendem Darmkrebs.
Die aus den Tumorzellen abgeleiteten Organoide behandelten sie mit dem Chemotherapeutikum Irinotecan. Der Organoidtest prognostizierte in mehr als 80 Prozent der Fälle den Therapieerfolg. Zwar konnten die Minitumore nicht den Effekte von anderen Chemotherapeutika vorhersagen. Aber sie könnten helfen, Krebspatienten unnötige Behandlungen auf Irinotecan-Basis zu ersparen.
So vielversprechend diese Studien sind, sie haben auch ihre Schwächen. Die Probandenzahlen sind eher klein, die Ergebnisse müssen sich erst noch in größeren klinischen Studien bestätigen. Unklar ist zudem, ob sich die Organoide auch bei anderen Krebsarten als Darmkrebs bewähren. Es gibt Tumore, bei denen auch die Umgebung im Körper eine sehr wichtige Rolle spielt. Doch bei den Organoiden fehlt genau diese Umgebung. »Tumororganoide enthalten nur Krebszellen, aber keine anderen Zellen eines Tumors im menschlichen Körper wie Blutgefäße oder Immunzellen«, sagt Hans Clevers. »Es werden gerade weltweit Anstrengungen unternommen, solche Zellen hinzuzufügen. Das wird aber noch einige Jahre dauern.«
»Man darf nicht vergessen, dass dieses Forschungsgebiet noch jung ist. Der Fortschritt ist rasant, und diese Probleme werden zunehmend beherrschbar«Oliver Brüstle, Stammzellforscher
Und es gibt weitere grundsätzliche Probleme von Organoiden: Durch das Fehlen von Blutgefäßen werden die Zellen im Zentrum eines Miniorgans ab einer bestimmten Größe nicht mehr ausreichend ernährt. Ihre Entwicklung gerät nach einiger Zeit ins Stocken, und sie kommen nicht über Erbsengröße hinaus. Dem Stammzellforscher Oliver Brüstle von der Universität Bonn zufolge sind Organoide daher besonders dafür geeignet, frühe Stufen der Entwicklung von Organen nachzubilden. »Daher sind sie vor allem für die Untersuchung solcher Erkrankungen relevant, die ihren Ursprung bereits in der frühen Entwicklung haben.« Mit Blick auf Hirnorganoide verweist er auf bestimmte psychiatrische Krankheiten. »Klassische neurodegenerative Erkrankungen sind hingegen an diesen frühen Strukturen schwieriger nachzustellen.«
Ähnlich äußerst sich Peter Ertl: Da oft embryonale oder induzierte pluripotente Stammzellen für Organoide herangezogen würden, ähnelten diese in ihrer Entwicklung stark embryonalen Strukturen. »Weil nun aber viele Erkrankungen fertig ausgebildete ›herangereifte‹ Gewebe betreffen, benötigen wir Organoide, die sich so verhalten wie die Organe der Patienten.« Man brauche also gewissermaßen »alte« herangereifte Organoide.
Oliver Brüstle sieht noch andere Hürden für Medikamententests. Es müssten viele Organoide parallel kultiviert werden, was im Moment noch eine technische Herausforderung sei. Da Organoide im Zuge biologischer Selbstorganisation entstehen, gebe es teilweise große Unterschiede zwischen den Organoiden. Sie seien daher nicht leicht zu standardisieren, und das führe bei Medikamententests zu experimentellem Rauschen. Dennoch blickt der Stammzellforscher optimistisch in die Zukunft: »Man darf nicht vergessen, dass dieses Forschungsgebiet noch jung ist. Der Fortschritt ist rasant, und diese Probleme werden zunehmend beherrschbar.«

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.